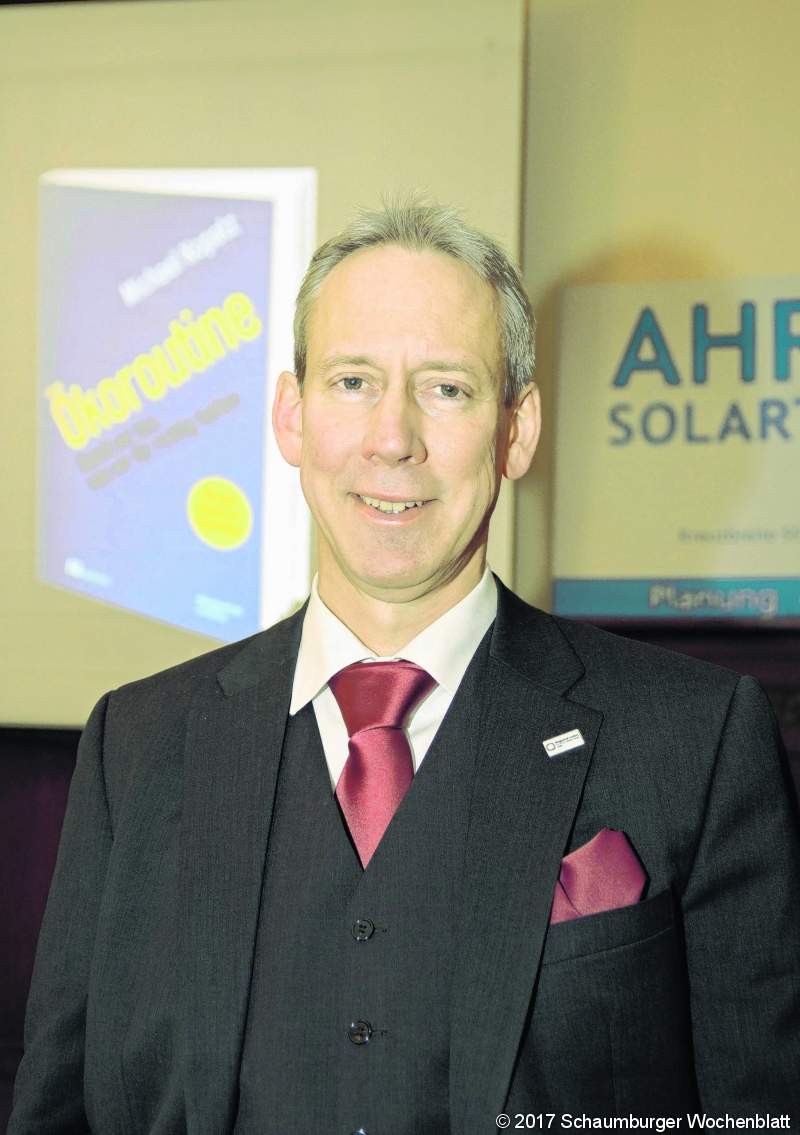BÜCKEBURG (wa). "Unsere Politik hat Naturzerstörung und Ressourcenverschwendung unter dem Mantel der "Notwendigkeit des Wachstums" längst zum Standard gemacht", schreibt Michael Kopatz Umweltwissenschaftler am Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie in seinem Buch "Ökoroutine - Damit wir tun, was wir für richtig halten". In seinem Werk richtet er sein Augenmerk nicht auf den Endverbraucher, den Bürger, sondern auf die Politik. Denn wie oft versucht man im Alltag die kleinen Dinge umzusetzen, weniger Fleisch oder gar keines essen, weniger Auto fahren, mehr öffentlicher Nahverkehr. LED statt Birne. Und am Ende des Tages passiert es doch und die Frage kommt auf: "Was soll ich schon alleine ausrichten?" Deshalb lautet Kopatz Appell: Strukturen verändern, statt Menschen. Psychologisch betrachtet ein sehr guter Ansatz, verändert der Mensch seinen Alltag nur ungern und der Einzelne möchte nicht "der Dumme" sein - sein Auto stehen lassen, während der Nachbar und die ganze Welt weiter machen wie bisher. In einem Impulsvortrag am Ende des Solartages in Bückeburg gab Kopatz einen Einblick, wie wir es denn schaffen könnten, zu tun, was wir für richtig halten.
Kopatz fordert radikale Vorgaben der Politik: Beispielsweise in der Massentierhaltung, auf den Straßen, bei der Arbeit und beim Konsum. "Unser Alltag ist geprägt von gelebter Schizophrenie. Teil unserer Kultur ist es beispielsweise, Milliarden für die Produkte zur Gesundheitsförderung auszugeben, während wir gleichzeitig schädliche Produkte essen", sagte Kopatz. Politiker schaffen es in einem Satz "Klimaschutz und den Ausbau der Autobahnen zu fordern". Und während Mensch seine Haustiere nahezu in Luxus schwelgen lässt, behandelt er Nutztiere wie tote Materie, sperrt sie in grausame Massenställe und verarbeitet sie zu billigem Fastfood. "Die industrielle Tierhaltung belastet nicht nur Böden, Wasser und Atemluft mit Schadstoffen. Sie sorgt auch dafür, dass sich multiresistente Keime ausbreiten", schreibt Kopatz. Und das, weil große Mengen Antibiotika in der Tierzucht eingesetzt werden um Seuchen unter Massen an Tieren auf kleinstem Raum zur reduzieren. Doch: Je weiter eine Bedrohung (Klimawandel) räumlich und zeitlich entfernt liegt, desto leichter fällt Mensch das Verdrängen und desto geringer ist auch die individuelle Handlungsmotivation. Das klappt bei Rauchern besonders gut, verweisen diese doch zu gern auf Helmut Schmidt, der als "Kettenraucher doch auch fast 100 Jahre alt geworden sei". "So wie die Zahl der Raucher nur zurückging, weil sich die Rahmenbedingungen gesetzlich geändert haben, so wird sich auch der Klimaschutz nur dann verselbstständigen, wenn wir ihn zur Routine machen", so Kopatz. So könne beispielsweise das Autofahren teurer werden und zugleich der öffentliche Nahverkehr und das Radeln attraktiver gemacht werden. Ohne gesetzliche Rahmenbedingungen wird Umweltschutz nur in "Alibibereichen" betrieben: Mülltrennung oder das Kaufen von Recyclingpapier. "Außerdem verrechnen wir innerlich verschiedene Handlungsstränge wie beispielsweise den Urlaubsflug mit dem Bioladen-Einkauf", erläuterte Kopatz. Hektik und Stress während der Arbeitszeit verursachen körperliche und seelische Beschwerden. Nichts Neues im Jahr 2017. Mehr Arbeit bedeutet auch höherer Ressourcenverbrauch. Kein ökologisches Bedenken scheint schwerer zu wiegen als das Argument: "Aber das schafft Arbeitsplätze". Doch mit dem Wohlstand der Menschen wächst auch der Energieverbrauch. Spitzenverdiener verbrauchen im Vergleich zu den Ärmsten dreimal so viel Energie und trotzdem wollen alle höher, schneller, weiter. Kopatz Vorschlag: "Kurze Arbeitszeiten sind ein erprobtes Konzept, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und den Wachstumsdruck zu lindern. Nur traut sich kaum jemand das offen auszusprechen." Rechnerisch ließe sich die Arbeitslosigkeit abschaffen, wenn jeder Arbeitnehmer in Deutschland und Umgebung nur noch 30 Stunden pro Woche arbeite. Kopatz plädiert deshalb für die "Kurze Vollzeit für alle". Vor allem müssten Unternehmen, die sich weiterhin an maximalen Profiten, statt an Wertschätzung, Kooperation, Solidarität und Teilen orientieren, die höchsten Steuern zahlen. Das Konzept der Ökoroutine verlangt nach möglichst einfachen Regeln. Als Schlüssel zu seinen Ansätzen im Buch benennt Kopatz Beharrlichkeit und einen langen Atem haben. An Demonstrationen beteiligen und als Bürger den Mund aufmachen, damit "wir tun, was wir für richtig halten". Foto:wa